Career Booster Nordamerika: Forschende in den USA und Kanada im Gespräch
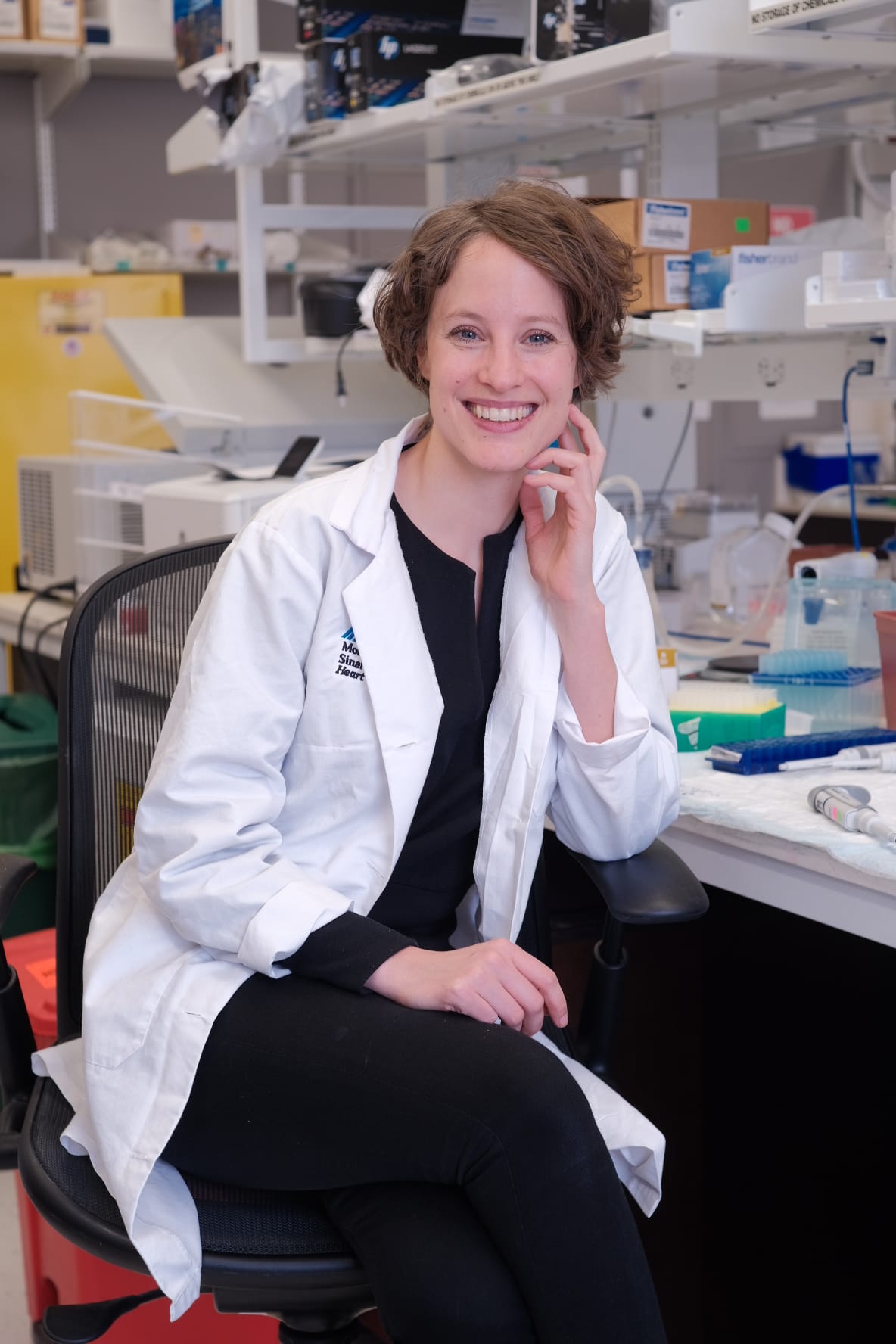
Teresa Gerhardt im Labor
© privat
(17.01.2024) Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert mit dem Forschungsstipendium und seit 2019 mit dem Walter Benjamin-Stipendium die Grundsteinlegung für wissenschaftliche Karrieren durch Finanzierung eines eigenen, unabhängigen Forschungsvorhabens im Ausland und seit 2019 auch in Deutschland. Ein großer Teil dieser Stipendien wird in den USA und zu einem kleineren Teil auch in Kanada wahrgenommen. In einer Reihe von Gesprächen möchten wir Ihnen einen Eindruck von der Bandbreite der DFG-Geförderten vermitteln. In dieser Ausgabe schauen wir, wer sich hinter der Fördernummer GE 3588 verbirgt.
DFG: Liebe Frau Dr. Gerhardt, herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Gespräch mit dem Nordamerika-Büro nehmen. Ihr Lebenslauf lässt auf lange, oder zu mindestens sehr produktive Wachphasen in Ihrem bisherigen Werdegang schließen. Sie befassen sich derzeit mit dem Einfluss von Schlaf auf entzündliche Prozesse und die kardiovaskuläre Gesundheit. Als Laie könnte man vermuten: Viel Schlaf = gesund, wenig Schlaf = ungesund. Wieviel schlafen Sie?
Teresa Gerhardt (TG): Ich habe für die Gelegenheit zu einem Gespräch zu danken und vor allem auch für das Stipendium, das mir einen großartigen Forschungsaufenthalt in New York ermöglicht. Ich schlafe gerne zwischen sieben und acht Stunden, was der generell empfohlenen Schlafdauer pro Nacht entspricht. Das sind allerdings Zahlen, die individuell durchaus Abweichungen erlauben, vor allem, wenn neuere, mit dem schönen Wort „Schlaf-Hygiene“ beschriebene Erkenntnisse zu Schlafqualität jenseits der idealen Dauer mit hinzukommen. Interessant ist: Ausreichend Schlaf ist für die Erhaltung der Leistungsfähigkeit und die Herzgesundheit wichtig, zu viel Schlaf – das gibt es auch – könnte nach neueren Studienergebnissen allerdings sogar kontraproduktiv für diese sein und die Entstehung von Herzinfarkten eher begünstigen.
DFG: Sie haben in Würzburg Ihr Abitur mit glatt Eins bestanden und dann gleich mit dem Medizinstudium in Freiburg begonnen. War der Weg in die Medizin für Sie schon während der Oberstufe – möglicherweise durch die Familie motiviert – vorgezeichnet und Sie haben daher Ihre schulischen Leistungen darauf hin ausgerichtet?
TG: Wäre es nach meinen Wünschen und Träumen als junger Teenager gegangen, dann würde ich jetzt meinen Lebensunterhalt an den Konzertflügeln dieser Welt verdienen. Ich hatte zwar relativ spät mit dem Klavierspiel angefangen, mir dann aber Zeit für die sprichwörtlichen zehntausend Stunden Praxis neben der Schule freigeschaufelt, manchmal sieben Stunden am Tag. Ich lief dann irgendwann mal, mit 15 oder 16 Jahren, in einen „reality check“ und bin rückblickend nicht ganz sicher, ob ich nun dankbar sein soll, dass mir die harte und sehr kompetitive Karriere als Pianistin erspart geblieben ist, oder verärgert, dass ich mich habe abschrecken lassen. Am Liebsten nehme ich natürlich beides mit und lasse mich jetzt und in Zukunft nicht mehr so leicht abschrecken.

Mit Partner bei einer Bergwanderung
© privat
Ja, meine Mutter und meine um zwei Jahre ältere Schwester Louisa sind beide Medizinerinnen und insofern ist meine Studienwahl nach dem Abitur keine Überraschung. Von meiner Mutter möchte ich vor allem ihre Durchsetzungskraft gelernt haben. Sie hat vergleichsweise spät in ihrem Leben ihre beiden Kinder bekommen und erfahren müssen, dass jedenfalls zu ihrer Zeit in der akademischen Medizin in Deutschland Vereinbarkeit von Beruf und Familie nicht so großgeschrieben wurde. Ich hoffe, dass wir an dieser Stelle, nicht zuletzt dank Menschen wie ihr, mittlerweile ein Stück weitergekommen sind.
DFG: Sie haben sich inzwischen in Richtung Kardiologie spezialisiert. Wie kam es dazu?
TG: Über den Weg der Auto-Immunologie und Entzündungsforschung während eines einjährigen Promotionsaufenthalts 2015 bei Professor Klaus Ley in La Jolla, Kalifornien. Er hat mich insbesondere mit seiner Idee fasziniert, eine Impfung gegen die Atherosklerose, die häufigste Ursache für Herzinfarkte und Schlaganfälle, zu entwickeln. Damit befasste sich dann auch mein Promotionsprojekt, das die Grundlage für mein späteres Interesse für Kardiologie war. Schön fand ich auch, dass er Forschung unter der Annahme betreibt, dass wir Krankheiten häufig nicht verstehen können, wenn wir sie isoliert betrachteten, und wir stattdessen komplexere Vorgänge in den Blick nehmen sollten. Auf seiner Webseite heißt es: „You don’t cure the disease by only looking at the disease. Very often cures come out of left field.“ Das klang sehr vernünftig und ich habe mich direkt beworben.
DFG: Sie möchten Ihren Forschungsaufenthalt hier in New York dazu nutzen, Ihr eigenes Forschungsprofil im Bereich von translationaler Forschung zu entwickeln und Lebensstil-abhängige und nicht-klassische Risiko-Faktoren für Atherosklerose und andere kardiovaskuläre Erkrankungen besser verstehen zu lernen. Welche Rolle spielt dabei der Schlaf?
TG: Wir sehen in den hochentwickelten Ländern bei kardiovaskulären Erkrankungen deutliche Fortschritte in der Behandlung bzw. Kontrolle klassischer Risikofaktoren wie Bluthochdruck, Diabetes oder Störungen des Fettstoffwechsels. Obwohl dies zu einem Rückgang kardiovaskulärer Erkrankungen und der damit verbundenen Todesfälle geführt hat, bleibt ein beträchtliches primäres und sekundäres kardiovaskuläres Risiko bestehen, welches durch klassische Risikofaktoren nicht erklärbar und damit nicht kontrollierbar ist. Es wird kaum überraschen, dass nun auch andere Faktoren mit in den Blick genommen werden, wobei Faktoren wie etwa Stress, wenig Bewegung oder schlechte Ernährung eher zu den üblichen Verdächtigen gehören. Beispielsweise weiß man aber auch aus epidemiologischen Studien, dass Insomnia und andere Schlafstörungen, aber auch zu langes Schlafen mit einem erhöhten Herzinfarktrisiko verbunden sind. Die genauen Mechanismen, warum das so ist, sind bisher sowohl in die eine als auch in die andere Richtung unbekannt und Gegenstand meiner Forschung.
DFG: Wie muss man sich die wissenschaftliche Untersuchung einer Fragestellung konkret vorstellen, die sich damit beschäftigt, wie sich Schlafqualität und -quantität auf die Herzgesundheit auswirkt?
TG: Für Projekte, die sich mit gestörtem oder zu kurzem Schlaf beschäftigen arbeiten wir hier im Lab vor allem mit Mäusen, die wir mittels spezieller „sleep fragmentation“-Käfige regelmäßig aufwecken. Diese sind kommerziell erhältlich. Außergewöhnlich und schwer zu beschaffen sind hingegen Mäuse, die sehr lange schlafen – also ca. 17 Stunden am Tag – so außergewöhnlich, dass wir sie hier selbst züchten müssen.
DFG: Woran liegt das?
TG: In Japan wurde vor einigen Jahren ein genetisch verändertes Mausmodell entdeckt, das eine Mutation im Sik3 Gen hat. Diese Mäuse schlafen außergewöhnlich viel, können aber in den USA oder Europa nicht einfach gekauft werden. Darum haben wir begonnen, unsere „Langschläfer“ mit aus Japan eingeflogenem Tiefkühl-Sperma selber zu züchten. Leider sind wird über das Problem gestolpert, dass die männliche Sik3 Maus wenig Interesse an Fortpflanzung hat – wahrscheinlich, weil sie ständig schläft. Daher zieht sich dieses Projekt etwas.

Gruppe im Lab
© privat
DFG: Ihr Forschungsgegenstand ist das Herz, ein Organ, dem außerwissenschaftlich noch zahlreiche andere Funktionen zugeschrieben werden als nur die einer Pumpe für den Blutkreislauf. Liegt Ihnen eine solche Bedeutung persönlich auch „am Herzen“?
TG: Zum einen: Das Herz ist nur eines von vielen Organen, bei denen es eine Meta-Ebene gibt, und ob nun gerade das Herz als Sitz der Seele angenommen wird, die Augen oder die Haut, spielt für mich als Kardiologin keine größere Rolle als für eine Dermatologin oder einen Augenarzt. Zum anderen: Auch als Ärztin und Forscherin bleibe ich für die große Liebe ebenso wie die Kunst der Schnulze so empfänglich wie Menschen, die weniger Ahnung von Ventrikeln und Atrien haben. Natürlich genieße ich Filme, Kunst oder Literatur, die ihre dramatische Spannung zum Teil aus solchen Meta-Ebenen bezieht. Alles andere wäre ja langweilig.
DFG: Sie sprechen im Konjunktiv. Kennen Sie Langeweile?
TG: Nein, dazu ist mein Leben jenseits des Berufs viel zu vielseitig und interessant. Mein Partner – übrigens auch mit einem Walter Benjamin-Stipendium in den USA – ist Philosoph, Soziologe und vielschreibender Autor im weiten Feld moralischer Diskurse. Meine vielen Gespräche mit ihm drehen sich sehr häufig um andere Dinge als meinen Alltag im Labor. Wenn wir darüber hinaus Gelegenheit haben, erwandern wir uns derzeit das Hudson Valley, so wie ich während meiner Zeit in San Diego mit dem Surfen angefangen habe und in Freiburg Rennrad gefahren bin. Wenn das Tageslicht knapp wird oder das Wetter schlecht, kann ich mich auch an Yoga oder Schwimmen erfreuen und lese darüber hinaus sehr gerne Belletristik, so gerne, dass ich mit meinem Partner und einer vielfältigen Gruppe von New Yorkern einen Lesezirkel gestartet habe.
DFG: Irgendwelche Tipps?
TG: Klar, großartig finde ich beispielsweise, was wir gerade im Zirkel besprechen: „In the Distance“ von Hernán Diaz und die Romane von Jon Fosse, zum Beispiel seine „Trilogy“. Diaz bezieht seine sprachliche Gewalt aus dem Wortreichtum, wie das vielleicht aus den Romanen von Gabriel García Márquez oder Thomas Mann bekannt ist, Fosse macht es dagegen über sprachliche Verknappung. Er verleiht seinen wenigeren Worten alttestamentarische Schwere, vergleichbar etwa mit Cormac McCarthy oder Robert Walser. Aber wir sind dann wohlgemerkt keine Wissenschaftlerinnen, sondern genießen einfach die Literatur.
DFG: Gibt es etwas, dass Sie hier in New York vermissen?
TG: Als Ärztin vermisse ich natürlich die Arbeit mit Patienten und auf Wanderungen die deutsche Vielfalt beim Sammeln von Pilzen, aber insgesamt bin ich hier sehr glücklich und fühle mich entsprechend tatkräftig.
DFG: In Ihrem Lebenslauf stehen neben Würzburg Aufenthalte in Freiburg und Berlin vermerkt, im Ausland so exotische Orte wie Martinique. Wo hat es Ihnen bislang am Besten gefallen, zum einen in Deutschland und zum anderen international?

Mit June, dem Hund der Laborleiterin
© privat
TG: In Deutschland hatte jede Stadt für mich ihren eigenen, nicht zu unterschätzenden Charme. International würde ich sofort wieder nach Montreal wollen, ungeachtet der guten Surfbedingungen in San Diego, dem Schick von London und dem karibischen Flair von Martinique. In London, Martinique und Montreal war ich während meines Praktischen Jahres nach dem Zweiten Staatsexamen und als ich von der Tropeninsel Martinique im winterlichen Montreal landete, hat man mir vielleicht den Schock über die 50 Grad Temperaturdifferenz ansehen können. Jedenfalls waren dort aber alle supernett zu mir, machten Gesprächsangebote auf Französisch und Englisch und das Krankenhaussystem mit flachen Hierarchien und exzellenter Patientenversorgung hat mir sehr zugesagt. Und man glaubt erst einmal gar nicht, in Nordamerika zu sein, auch architektonisch und von der Vielfalt des kulturellen Angebots her.
DFG: Wie soll es nach Ihrem Forschungsaufenthalt hier in New York weitergehen?
TG: Ich hoffe natürlich auf einen möglichst ertragreichen Aufenthalt hier, so ertragreich, dass Gutachtende in mir weiterhin ein außergewöhnlich hohes akademisches Potenzial sehen und ich dann zurück in Deutschland die Leitung einer Forschungsgruppe einwerben kann, beispielsweise durch Förderung im Emmy-Noether-Programm. Ich möchte dann auch noch meine Facharztausbildung abschließen und mich habilitieren und dann schauen mein Partner und ich mal, in welche Gegend Deutschlands oder Europas es uns verschlägt. Lassen Sie mich aber noch etwas anfügen: Für einen Forschungsaufenthalt, der so ertragreich ist, dass er weitere Spitzenforschung wahrscheinlich macht, sind zwei Jahre eigentlich zu kurz, vor allem, wenn die Experimente länger dauern. Das funktioniert bei mir nur unter drei Bedingungen. Erstens darf ich mich mit dem Stipendium der DFG sehr stark auf mein Projekt konzentrieren und das lässt sich kaum hoch genug anrechnen, zweitens ist das wissenschaftliche Umfeld hier außergewöhnlich günstig, also erst einmal die Gruppe von Cameron McAlpine und darüber hinaus auch das Mount Sinai Cardiovascular Research Institute unter der Leitung von Professor Filip Swirski. Und drittens brauchen Sie auch eine sehr gute wissenschaftliche Fragestellung für Ihr Projekt. Was da gut ist und was weniger gut, lernt man in der Regel durch Gutachterhinweise (wenn die Gutachter ihre Aufgabe ernst genommen haben) und durch einen guten Mentor. Cameron ist ein exzellenter Mentor, er ist sehr begeisterungsfähig und kann begeistern und wenn ich seine Art, Wissenschaft zu betreiben, in einer ästhetischen Kategorie beschreiben darf, dann würde ich sie „schön“ nennen.
DFG: Schönheit scheint abseits der Mathematik zur Beschreibung von Wissenschaft vielleicht zu selten Beachtung zu finden und darum sind wir für diesen Hinweis dankbar. Außerdem möchten wir Ihnen herzlich für das interessante Gespräch danken und Ihnen für Ihre berufliche und private Zukunft alles erdenklich Gute wünschen.